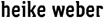DER EIGENSINN DES ROTEN FADENS
Die Aufgabe, die dem Zeichner gestellt wurde erscheint einfach. Er soll, beauftragt von der Frau des abwesenden Schlossherrn, dessen Besitz von allen Seiten wirklichkeitsgetreu bis in jedes Detail hinein wiedergeben. Die fertigen Zeichnungen sind als Geschenk für den Schlossherrn gedacht. Das Problem, das sich in der Folge ergibt, resultiert ausschließlich aus der Sorgfalt des Zeichners bei der Erfüllung seines Auftrags. Ausgerüstet mit einer Staffelei und einem Raster, mit dem sich die Ansicht der Gebäude in Koordinatenfelder unterteilen lässt, überträgt er das, was vor ihm liegt so exakt auf das Papier, dass seine Zeichnungen auch die dem flüchtigen Auge verborgen bleibenden Indizien erfassen, aus denen ein Mord an dem Schlossherrn rekonstruiert werden kann. Schlußendlich ist es so die Genauigkeit seines retinal-zeichnerischen Rapports, für die der Zeichner büßen muss. Der Kriminalist wider Willen wird nun selbst das Opfer eines Mordkomplotts. Nachdem solchermassen der einzige Zeuge beseitigt ist, dreht sich die Gesellschaft zu einer eleganten, dem Barock nachempfundenen Filmmusik weiter im Kreise einer perfekten, symmetriesüchtigen Harmonie.
Peter Greenaways epochaler 1982 erschienener Film “The Draughtmans Contract” verblüfft auch aus heutiger Sicht noch mit der Fülle seiner Anspielungsebenen, von denen an dieser Stelle allerdings nicht weiter die Rede sein soll. Wichtig erscheint hier allein die filmische Analyse der Zeichnung als Medium einer mimetischen Exaktheit, aus der sich sowohl ihre Bedeutung, wie auch ihre Gefährdung ergibt. Im Greenawayschen Diskurs arbeitet der Zeichner an der Erfüllung eines Fantasmas, dem sich die Malerei seit der Renaissance und im Grunde bis ins 19. Jahrhundert hinein verschrieben hat: Der Übertragung der Welt ins Bild.
Im Film und seiner Perspektive des 17. Jahrhunderts nimmt die Zeichnung dabei die Stellung und Aufgabe wahr, die sehr viel später der Fotografie zugemutet wird: Ohne subjektive Interpretation und Verfälschung all das zu erfassen, was tatsächlich vorhanden ist. Der Tod des Zeichners ist insofern nicht nur eine Konsequenz aus der Handlungslogik des Films, sondern begründet sich wesentlich aus der medialen Paradoxie, die diesem “Kontrakt des Zeichners” zugrundeliegt. Gelingt die ihm gestellte Aufgabe nicht, erweist er sich als nutzlos, weil er die Forderung nach mimetischer Exaktheit offensichtlich nicht erfüllen kann. Bewältigt er dagegen sein Projekt in der oben beschriebenen Weise, wird er gleich aus zwei Gründen überflüssig: Zum einen, weil er tatsächlich den getreuen Spiegel des Wirklichen geschaffen hat, dem sich nichts mehr hinzufügen und von dem sich auch nichts mehr wegnehmen lässt. Zum anderen, weil er damit sozusagen die Grenzen des Mediums in Richtung einer fotografischen Genauigkeit überschritten hat, die statt auf Nachahmung auf eine vollständige Übertragung und indexalische Berührung mit ihren Bildgegenständen zielt.
In allen Arbeiten Heike Webers findet man so etwas wie einen fernen Nachhall eines solchen paradoxalen zeichnerischen Vertrags, in dem die strukturelle Präzision der Linie zu einem Versprechen für die Möglichkeit wird, Dinge nicht nur zu bezeichnen, sondern sie sozusagen aus dem Akt der Bezeichnung herauszuheben, sie exakt zu lokalisieren und zu fixieren, und damit wirklich werden zu lassen. Seit 1998 verwirklicht Heike Weber raumgreifende Bodenzeichnungen, beispielsweise in der Städtischen Galerie Villa Zanders in Bergisch Gladbach, im Kunstverein Arnsberg oder im Kunstverein Göttingen, bei denen eigens verlegte weiße PVC-Böden mit zumeist rotem Permanentmarkerlinien überzogen werden. So klar und nachvollziehbar das Verfahren ist, so komplex und ambivalent ist andererseits die Wirkung. Da sich die Linie in allen Fällen am bestehenden Raum orientiert, und diesem bis in jeden Mauervorsprung in jede Unregelmäßigkeit hinein folgt, funktioniert sie tatsächlich indexikalisch, zielt also auf die Berührung mit dem Tatsächlichen und erscheint als deiktisches Moment der Verortung. Indem die Künstlerin diesen Akt des zeichnerischen Nachvollzugs eines Raums (zumeist) von aussen nach innen permanent wiederholt und dabei auch jede Störung der ursprünglichen Linie getreulich wieder aufgreift, verwandelt sich der initiale Verortungsgestus aber auch in sein Gegenteil und wird zur Erfahrung von Labyrinthik und Desorientierung. Wie Wellen, die von einem ins Wasser geworfenen Stein ausgehen, scheinen sich die roten Lineaturen in mäandernd kreisförmigen Bewegungen von ihrem Zentrum aus in den Raum auszubreiten, obwohl sie – jedenfalls in den meisten Fällen – tatsächlich von aussen nach innen verlaufen, den Raum also klaustrophobisch verengen.
In der gleichen paradoxen Dialektik funktioniert der weiße, zusätzlich eingezogene PVC-Boden, auf dem Heike Weber ihre labyrinthisch-präzisen Bodenzeichnungen entwirft. Jenseits der pragmatischen Erwägung, einen einfach zu benutzenden, neutralen Untergrund für die geplante Zeichnung zur Verfügung zu haben, sind die Kunststoffböden einerseits Elemente, durch die der Raum in seinen Grundrissen verdoppelt, und damit als Raum buchstäblich ausgestellt wird. Andererseits transformiert der neutrale weiße Grund aber auch die tatsächliche Raumwirklichkeit hin zu einer künstlichen, ortlosen Modellhaftigkeit, die den durch die Linien hervorgerufenen Eindruck von Gleichgewichtsstörung und einem Verlust an Orts- und Bodenhaftung noch signifikant steigert. In durchaus beabsichtigter Doppelbödigkeit sind also alle Elemente dieser Arbeit bis hin zu der unbestreitbaren Ähnlichkeit der roten Lineaturen mit Höhenlinien auf Landkarten durch eine strukturelle Ambivalenz zwischen Lozierung und Dislozierung gekennzeichnet. Das bedeutet auch: Alle diese Zeichnungen folgen ebenso sehr dem Raum, wie sie andererseits, in der fiebrig-obsessiven halbautomatischen Mechanik, mit der sie jeden Schlenker der Ursprungslinie wiederholen, ausschließlich mit sich selbst beschäftigt sind. Die Tatsache, dass sich alle diese Zeichnungen auf die Böden und gegebenenfalls auch die Wände von Räumen beziehen, macht darüberhinaus deutlich, wie sehr Heike Webers zeichnerischer Furor einerseits die Flächigkeit der klassischen Zeichnung mitbedenkt und diese andererseits zu einer begehbaren, räumlichen Gesamtsituation erweitert, in der die übliche Distanz zwischen Betrachter und Zeichnung aufgehoben wird. So tritt an die Stelle eines kontemplativen Schauens, das Überblick und Ordnung verspricht, ein kreisender Raumwirbel, der dem Betrachter, der in diesem Fall immer auch ein aus der Zeichnung heraus Betrachteter ist, buchstäblich den Boden unter den Füßen entziehen kann.
Die eben skizzierten Aspekte lassen sich auch auf die Bergpanoramen übertragen, die im Mittelpunkt der neuesten Werkgruppe und damit auch der Ausstellung im Kunstmuseum Bonn stehen. Wiederum folgt der Prozess der Arbeit der für das Gesamtwerk eigentümlichen Mischung aus fast kartografisch genauer Bezeichnungslogik und mäandernden, sich labyrinthisch verästelnden Selbstumkreisungen. Ausgangspunkt für das Projekt bilden gefundene, wie selbstfotografierte Fotos von Berglandschaften, die in Zeichnungen umgesetzt werden. Diese Einzelzeichnungen werden zu langen Panoramen aneinandergefügt, per Episkop auf die Wand projiziert und schließlich mit silbernen Dekonadeln und roter Wäscheleine direkt auf der Wand nachvollzogen. Doris Krystof verdanken wir den schönen Hinweis, dass die Herstellung des Bildes dabei tatsächlich an den Akt des Bergsteigens selbst erinnert: “Wie beim Bergsteigen, wo langsam und konzentriert Haken für Haken in die Wand geschlagen wird, und wo man sich allmählich mit Seil und Karabiner vorsichtig fortbewegt, entwickelt sich die Linienführung der Zeichnung kontinuierlich von einem Nagel zum nächsten” (Doris Krystof: Shifting the Ground. Heike Webers zeichnerisches Fundament, in: Heike Weber, f.o.b, Galerie Stefan Rasche, Münster, 2000 (Katalog) ). Die Wahl des Bergthemas erweist sich für Heike Weber aber auch deswegen als glücklich, weil das Motiv selbst in hohem Maße mit der Suche nach Verortung und dem dabei stets drohenden Verlust an Orientierung verknüpft ist. Schon die Theorie des Sublimen, wie sie maßgeblich von Edmund Burke entwickelt wurde, metaphorisiert die ferne schneeweiße Kälte der Bergriesen zu einem Ordnungsparameter idealer Schönheit, das den Menschen, versuchte er denn diesen Ort zu betreten, vernichten würde. Erst dadurch werden die Berge zum Thema der Malerei, weil sich so der Schrecken tatsächlicher Desorientierung im lebensfeindlichen Umfeld des sauerstoffarmen ewigen Eises zum konsumierbaren Bildes eines ästhetischen Ideals umfunktionieren lässt. Aber auch aus heutiger Sicht, welche die Berge dank vielfältiger touristischer Erschließungen so dicht an uns herangerückt hat, dass wir den Schauder der unberührbaren Ferne eigentlich kaum noch spüren können, wecken Gebirgspanoramen metaphorisch wie real reflexartig das Bedürfnis nach Orientierung und kartografischer Zuschreibung. Wer kennt nicht dieses Gefühl, auf dem Gipfel eines Berges, umgeben von einer Fülle markanter und weniger markanter anderer Berge, all das sofort identifizieren zu wollen, was man sieht, und gleichzeitig diese milde Frustration, wenn eben das nicht gelingt, weil die entsprechende Orientierungstafel fehlt.
Heike Webers wäscheleinengeknüpfte Gebirgsabwicklungen spielen mit dem panoramatischen Versprechen nach Übersicht und Klarheit, um es dann systematisch zu enttäuschen. Die völlig unterschiedlichen Höhenkämme, die hier zu einem nur formal harmonisierten Ensemble aneinandergereiht werden, ergeben aus der Ferne betrachtet ein Gebirgspanorama, das buchstäblich in der Luft hängt und durch seine collagiert-fragmentierte Herstellungsweise zwar vage gegenständlich entzifferbar ist, gerade deswegen aber auch völlig unlokalisierbar bleibt. Aus der Nähe gesehen dagegen löst sich selbst die Gegenständlichlichkeit zugunsten der Abstraktion eines von hunderten von Knotenpunkten unterbrochenen roten Verlaufs auf, der einer völlig rätselhaft bleibenden Spur zu folgen scheint. Das Verfahren Heike Webers könnte man dabei als eine Art Meta-Zeichnung begreifen. Die entlang der Dekostifte verlaufende und immer wieder um sie geknotete Wäscheleine formuliert sich wie die Visualisierung eines materiellen Nachvollzugs dessen, was ursprünglich einmal reale Zeichnung war. Dazu passt die Tatsache, dass die Wäscheleine durch die Dekostifte in mehreren Zentimetern Abstand von der Wand gehalten wird. Ihr Abstand verdeutlicht den Raum, der zwischen dieser Linie und der einstigen gezeichneten Linie liegt, an die der Schatten erinnert, den die Leine auf die Wand wirft.
Dass die Künstlerin für ihre Investigationen Wäscheleinen benützt, hat zunächst, wie viele ihrer Entscheidungen, damit zu tun, das Instrumentarium pragmatisch, alltäglich und einfach zu halten. Weiter gedacht, eignet sich eine Wäscheleine aber schon deswegen gut für die Ziele Heike Webers, weil sich an ihr metaphorisch gesehen tatsächlich vieles aufhängen lässt, nicht nur ein Gebirgspanorama, sondern möglicherweise sogar die Idee eines Blutkreislaufs, der sich rot verästelt über die Wände zieht und den retinal herausfordernden Signalfarbencharakter, der dem Rot anhaftet, in eine liquide Zirkulation versetzt. Darüberhinaus ist aber auch die nüchterne Kunststoffmaterialität der Leine ein wichtiger Grund dafür, sie zu verwenden, verweigert ihre offensichtlich billige Künstlichkeit doch jeden Transfer in Richtung auf eine materialwarme Emotionalisierung, wie sie beispielsweise durch einen Bindfaden transportiert würde.
Die Dekostifte, die der Wäscheleine ihren Weg vorgeben, sind, analog zu der ambivalenten Gesamtstruktur des Werks, nicht nur die Wegweiser für die lineare Dynamik, sondern immer auch deren Unterbrechung. Als in die Wand getriebene Haltepunkte stellen sie ein machtvolles Gegenbild zu der Idee vom spontanen, unmittelbaren Fluss dar, der mit dem Medium der Zeichnung gemeinhin verknüpft wird. In ähnlicher Weise lassen sich auch die Knotungen begreifen, wenn man einmal von ihrem pragmatischen Zweck der Fixierung der Wäscheleine absieht. Auch sie bilden in ihren eng geknüpften Schleifen eine Fülle von Barrieren gegen den ungehinderten Fortlauf der Linie. Wie ein permanentes Stottern halten sie nicht nur die Wäscheleine, sondern auch unseren Blick auf, der solchermaßen nicht mehr alleine dem Verlauf der Linie folgt, sondern auch ihre Selbstreflexion zwischen Zeichnung, Raumbild und Selbstbezeichnung mit beobachtet. Diese komplexe Mischung der Arbeit, in der sich skulpturale Erwägungen, Raumgreifendes, Zeichnung und Metazeichnung unentwegt ineinander verknoten und damit das Generalthema einer durchgreifenden Ambivalenz zwischen Orientierung und Desorientierung auch medial aufgreifen, wird nirgendwo deutlicher, als an den Stellen der Arbeit, an denen Heike Weber ein kleines Stück Wäscheleine unverbunden um einen einzelnen Dekostift schlingt. Wie ein perfekter Haiku steckt dieses Stück auf der Wand: Eine Markierung, die auf etwas Gesehenes verweist und sich im Verlauf seiner mehrfachen Ableitungen nun hin zu etwas entwickelt hat, das völlig mit sich selbst beschäftigt ist. Was der Knoten zeigt, ist wie Zeichnung funktioniert, wenn sie nicht mehr unmittelbar verfügbar ist, wenn sie sich selbst sozusagen aus der Ferne zusieht, und als ambivalente Projektion entwirft.
Dabei bleibt logischerweise jegliche Eindeutigkeit auf der Strecke. Die Verknotung ist ein Bild für den sowohl skulpturalen und raumgreifenden, wie flächigen und bildhaften Anspruch der Arbeit. Der Knoten um den Dekostift ist ebenso Bezeichnung, wie Selbstbezeichnung, als Schlinge hängt er ebenso an sich selbst fest, wie an dem, woran er geschlungen wurde. Insofern ist er ein unlösbares Paradox, und ein wunderbares Bild. Gäbe es ihn nicht, man müsste ihn erfinden.
Stephan Berg