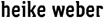Heike Weber im Gespräch am 25.4.97
Michael Krajewski: Heike, was wirst Du im „windows 1997“-Container am Grabbeplatz in Düsseldorf zeigen?
Heike Weber: Ich werde die weiß gestrichenen Innenwände des Containers mit weißen Haarnetzen bespannen.
K.: Wie gehst Du dabei vor?
W.: Die Netze werden auf Stecknadeln gespannt, mit 2-3 cm Distanz zur Wand. Zwischen den rechteckig angeordneten Netzen
bleibt ein Abstand von etwa 5 mm - das werde ich vorher exakt berechnen -, der so schmal ist, daß die Wand als homogene
Fläche wahrgenommen wird, fast wie gekachelt aussieht.
K.: Haarnetze sind sehr fein; man soll nicht auf den ersten Blick bemerken, daß jemand ein Netz im Haar trägt. Wird man
diese Verspannung überhaupt sehen können?
W.: Man muß sich Zeit nehmen, um die Arbeit wahrzunehmen, sie zu sehen und auch zu spüren. Eine solche Verspannung ist
im hohen Maße raumabhängig. In den unterschiedlichen Räumen haben sich auch inhaltliche Aspekte der Arbeit geändert.
Ich rechne damit, daß ein Großteil der Passanten, die nicht eigens des Containers wegen kommen, daran vorbeilaufen werden.
Denn das Geflecht ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen - außer wenn die Sonne darauf scheint und ein schönes
Schattenspiel entsteht, die Netze das Sonnenlicht aufnehmen. Dagegen „weicht“ die Installation bei diffusem Tageslicht
oder bei Kunstlicht die Wände „auf“. Wenn man durch das Schaufenster auf die weißen Wände blickt und nichts Bestimmtes
erwartet, bekommt man ein eigenartiges Gefühl. Je länger man dann hinsieht, desto mehr wird man sehen.
K.: Du hast ähnliche Verspannungen vorher an Orten ausgeführt, die ganz anders aussahen?
W.: Ja. Darauf gebracht haben mich Styropor-Skulpturen, große Kästen aus 1 mm dünn geschliffenem Styropor, die ich vorher
gemacht hatte. Auch diese strengen Kuben entsprachen nicht der Erwartung des Betrachters, weil ihre Wirkung außergewöhnlich
lichtabhängig war und sie sich bei jedem Luftzug bewegten. Sie entwickelten ein starkes Eigenleben trotz ihrer strengen Form.
Davon ausgehend, habe ich dieses Prinzip auf den Raum mit Haarnetzen übertragen. Für „Maikäfer flieg“ (eine von Uta Weber
und mir organisierte Gruppenausstellung mit Künstlern aus Tschechien, Großbritannien und Deutschland in einem Luftschutzbunker, 1995)
habe ich in zwei Treppenaufgängen Haarnetze aufgespannt, allerdings nicht in Weiß, sondern in der Farbe der Wände.
K.: Es waren Betonwände mit verwitterten Farbresten, einem zum Teil abblätternden Anstrich. Die Netze hingen direkt
unter einer grellen Neonlampe.
W.: Das Licht fiel so, daß man sie erst dann sehen konnte, wenn man unmittelbar davor stand. Der Ort der Installation -
das Treppenhaus zwischen den beiden Ausstellungsebenen - hat diese Beiläufigkeit psychologisch verstärkt. Mir gefällt das.
In diesem Bunker bekam die Arbeit einen anderen Aspekt, beschränkte sich nicht auf den sinnlichen Reiz. Obwohl es sich im Grunde
um eine ganz simple Arbeit handelte - ein Haarnetz war rechteckig neben dem nächsten angeordnet-, weckte sie an diesem Ort
verschiedene Bilder: zum einen visuelle Analogien, zum anderen Assoziationen. Die Haarnetze schienen, ähnlich wie etwa die
riesigen Drahtnetze in den Bergen Gesteinsbrocken halten, die grobe Wand zu schützen, die im Bunker ja selber Schutz bedeutet
und verwiesen im Wechselspiel der Funktionalitäten den Betrachter auf den besonderen Charakter dieses Ortes. Das harte Neonlicht
machte es dabei noch schwerer, die Zartheit der Netze zu erfassen.
Die Assoziationen bekamen in Verbindung zum Bunker einen inhaltlichen, erzählerischen Aspekt. Gedanklich ordnet man Haarnetze
eher den älteren Frauen der vorigen Generationen zu, was damit wiederum auf die Entstehungszeit des Bunkers und die Menschen,
die hier einmal Schutz suchten, verweist. Für diese Arbeit fand ich das akzeptabel, aber es reizte mich, so etwas in einer
neutraleren Umgebung zu machen.
K.: In einem Ausstellungsraum, wie 1996 in der Galerie Otto Schweins?
W.: Ich wollte Netze gerne in einem weißen Raum verspannen, der nicht so viele erzählerische Komponenten enthält, wo die Arbeit
formaler und inhaltlich purer wird und das Medium Haarnetz zurücktritt. Ich wollte, daß der Betrachter in den Raum eintritt und
die Arbeit erst einmal spürt und nicht sieht, daß er körperlich konfrontiert und an eine Grenze des Wahrnehmbaren herangeführt
wird. Das funktioniert nur im Raum, nicht an Wandstücken. Die Arbeit muß einen umgeben. Auch für den Container ist es wichtig,
daß die Netze rundherum verspannt werden, damit man wirklich das Gefühl hat, es geht um den ganzen Raum und nicht nur um ein Bild.
K.: Der Container ist nicht zu betreten, die Installation nur von außen zu betrachten. Wird sie auch so eine räumliche Wirkung
erzielen können?
W.: Das hängt von den Lichtverhältnissen ab. Ursprünglich hatte ich befürchtet, daß ein Reiz verloren geht, gerade im Vergleich
zu meiner Ausstellung bei Otto Schweins, wo man an die Wand herantreten und die Installation von der Seite betrachten konnte.
Doch auch im Container, dessen Glasscheibe bis zum Rand reicht, sind verschiedene Ansichten möglich. Zwar wird es Spiegelungen von
außen geben, was ich aber akzeptabel finde. Mich interessiert es nicht, eine Arbeit einfach nur in einem anderen Raum zu wiederholen.
Es kommt durch diese Abgeschlossenheit eine neue Komponente hinzu- eine Verdoppelung des Inhalts, dessen, was der Raum ist.
K.: Du könntest Dir nicht vorstellen, eine weitere Skulptur hinein zu stellen?
W.: Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde die Dinge nicht mischen. Es geht visuell und inhaltlich um den Raum. Dieser minimale Eingriff
setzt mehr in Bewegung, als man sieht. Es handelt sich um keine Wandarbeit, es geht nicht um das Material, sondern um die Wahrnehmung
von Raum.
K.: Im Zusammenhang mit Deinen Styropor-Skulpturen hast Du erwähnt, daß Dich leichtes, nicht solides Material interessiert. Wände sind
plan, sind geometrische Körper und suggerieren Rationalität.
W.: Ja, auch Kalkulierbarkeit, was ich noch interessanter finde. Meine Arbeiten entwickeln sich fast immer aus einer strengen Form -
entweder aus einem rechtwinkligen Raum oder aus den schon erwähnten Kuben; das gilt auch für die älteren Drahtskulpturen. Jetzt fertige
ich mit Schultinte und Tintenkillern Wandzeichnungen an, die die Betrachtung des Raums verändern. Ich arbeite mit rationalen oder strengen,
also nicht amorphen Formen. Nur setze ich dann durch die Wahl der Materialien und ihrer Verwendung einen Widerspruch in Gang. Eine solche
Installation irritiert, weil der Raum seiner ursprünglichen Funktion enthoben ist, also die Wand nicht mehr so funktionieren kann, wie es
von ihr erwartet wird. Das war bei meinen früheren Arbeiten ähnlich: Die Drahtkörper, die alle die gleichen Maße haben, biegen sich
unvorhersehbar; die Rationalität des Kubus ist aufgehoben. Das gilt auch für die sich schlängelnden Linien, die ich auf die Wand zeichne:
sie wird destabilisiert. Die Grenzen des Raums werden fragwürdig.