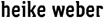Michael Stoeber
Das (Lehrzeichen zu viel) trunkene Ich
Zum Werk von Heike Weber
Zeichnung ist Weltaneignung. In ihr vollzieht sich eine Art Kurzschluss zwischen Auge und Hand, Wahrnehmung und Darstellung, Einfall und Skizze. Bevor die Zeichnung zu einem Medium sui generis wird, zu einer künstlerischen Disziplin aus eigenem Recht, hat sie dienende Funktion. In ihr hält der Maler die Ideen zu seinen Bildern fest. Weil die Zeichnung deren Konzepte und damit ihren inneren Kern trägt, ihre geistige Substanz, dauert es nicht lange, bis sie genau dafür geschätzt wird. Bereits in der Renaissance erfreut sie sich großer und stetig wachsender Beliebtheit. In der Folge emanzipiert sich die Zeichnung immer stärker von der Malerei und wird zu einem eigenen und eigenständigen Medium, in dem sich die Signatur des Künstlers besonders stark und prägnant ausdrückt. In diesem Sinne versteht sich auch Heike Weber als Zeichnerin. Was verblüfft, wenn man auf ihre Werke schaut. Denn ihre Zeichnungen sind keineswegs in erster Linie Papierarbeiten im herkömmlichen Sinne. In der Hauptsache bedecken sie Wände und Böden, ja ganze Räume. Bei Webers Eingriffen und Interventionen entstehen sehr häufig in situ – Arbeiten. Sie hat eine Manier, sich bei ihren Werken auf den Raum zu beziehen und vom Raum auszugehen, wie wir das eher von Bildhauern als von Zeichnern kennen. Für Heike Weber ist die Zeichnung in diesem Fall kein Medium für ein fremdes Konzept, sondern selbst das Konzept. Dabei sind ihre Raumzeichnungen so stark und präsent, dass niemand, der sie einmal gesehen hat, sie je wieder vergessen wird. Bekannt geworden ist die Künstlerin mit Werken, bei denen sie mit Hilfe eines roten oder blauen Permanentmarkers Räume durch Zeichnungen in geradezu atemberaubender Weise verwandelt. Ihre Strategie ist ganz einfach. Den Boden des Raumes, den sie bearbeiten will, legt sie mit weißem PVC aus und macht ihn so ganz buchstäblich zum white cube. Er gibt dann aber nicht das nüchterne Gehäuse für ihre Werke ab, sondern wird selbst zum Bildträger, wobei er sich magisch verwandelt. Der Ausgangspunkt der Zeichnungen ist entweder eine Säule im Raum, ein Wandvorsprung oder ein Treppenabsatz. Sie bilden die Motive, an denen die Künstlerin bei ihren Interventionen Maß nimmt. Webers Stift fährt ihre Konturen nach. Die nächste Linie orientiert sich dann an der vorangegangenen, nicht mehr am Motiv und so weiter. (so ein bißchen unpräzise?) Von freier Hand ausgeführt, geraten die Linien dabei immer stärker in Bewegung und mit ihnen die Koordinaten ihres Konzepts. Das Eckige wird sehr bald rund und das Gerade wellig. Und am Ende ist nichts mehr, wie es am Anfang war.
Das trunkene Schiff Beim Blick auf einen von Heike Weber in dieser Weise bearbeiteten Boden hat der Betrachter das Gefühl, dass er unter seinen Füße nicht mehr wie gewohnt still daliegt, sondern rumort und den Aufstand probt. Als sei er lebendig geworden und wolle ausbrechen aus der üblichen Trägheit und Lethargie seines statischen Seins. Das ist ein bisschen so, als gebe die Künstlerin mit ihrer Intervention nicht nur einem leblosen Artefakt Atem, sondern stelle auch die Naturgesetze auf den Kopf. Ein solcher Boden aus schwingenden, tanzenden Linien, der das Orthogonale und Rechtwinkelige der Architektur narrt und verspottet, ist mehr als nur eine eindrucksvolle Übung in Ornament und Dekor. Der sich auf ihm befindende Betrachter, der ihn mit den Augen abläuft, glaubt in alle möglichen Bewegungszustände zu geraten. Er meint zu fallen und zu fliegen, zu stürzen und zu schwimmen. Nur eines glaubt er nicht, still zu stehen, was er indes gerade tut. Webers Böden sprechen gleichermaßen zu unserem Geist wie zu unseren Sinnen. Als Sinn suchende Wesen entdecken wir hinter ihrer Ornamentik berückende Gleichnisse. Die schwelgenden, spottlustigen Linien der Künstlerin verleugnen den Wirklichkeitssinn und feiern den Möglichkeitssinn, dessen Schönheit zu loben Ulrich, der Protagonist in Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“ nicht müde wird. Wir könnten auch weiter zurückgehen in der Zeit beim Anblick des rauschenden Festes dieser Linien und an Friedrich Nietzsche denken, der in der dionysischen Lust des Menschen, in seiner Sehnsucht nach Hingabe, Grenzüberschreitung und Ekstase, dessen ursprüngliche Bestimmung sah. Dahinter steht der Versuch, in der Intensität des Lebens den Tod zu vergessen. Nicht von ungefähr wird Dionysos, der Gott des Weines, im Wahnsinn von den Mänaden, seinen wilden Begleiterinnen, zerrissen. Eros und Thanatos sind im Mythos innig aufeinander bezogen. Aber auch Karl Marx könnte einem einfallen im Angesicht dieser rauschhaften Ornamente und seine schöne (ein Lehrzeichen zu viel) Empfehlung, die poetisch in Frage stellt, was in unbefriedigender Weise ist. Man solle, so der Philosoph, den herrschenden Verhältnissen doch, bitte, ihre ureigene Melodie vorspielen, um sie zum Tanzen zu bringen. Genau das tut Heike Weber in ihren Zeichnungen, wenn sie den rechten Winkel daran erinnert, dass es auch noch weitere Existenzweisen gibt. Von denen hat im neunzehnten Jahrhundert noch ein anderer jenseits des Rheins geträumt. Arthur Rimbaud, der sein Ich als trunkenes Schiff, als „bateau ivre“, auf Reisen schickte. Und uns mit ihm.
Die Freiheit des Ornaments Von Adolf Loos ist das berühmt berüchtigte Verdikt überliefert, das Ornament sei ein Verbrechen. Zu seiner Zeit war das bestimmt so, weil sich die Ornamente als ästhetische Zuckerbäckerei zeigten, an denen sich die Menschen, wenn schon nicht die Mägen, dann doch die Augen verdarben. Gegen ihren Synkretismus und ihre Mythenseligkeit stellte der Wiener Architekt seine schmucklosen Bauten, die einen Bauhausstil 'avant la lettre' zelebrierten. Das Haus mit der strengen und ornamentlosen Fassade, das er für das Bekleidungsunternehmen Goldmann & Salatsch 1910 am Michaelerplatz gegenüber der Hofburg errichten ließ, war dem regierenden Kaiser Franz Joseph ein so ärgerlicher Dorn im Auge, dass er sich geweigert haben soll, für den Rest seines Lebens durch die Fenster der Hofburg auf den Michaelerplatz zu schauen. Aber natürlich ist auch die Abwesenheit des Ornaments in gewisser Weise ein Ornament, so wie die Schmucklosigkeit ein Schmuck sein kann. Ornare heißt im Lateinischen schmücken, und jede Form ästhetischer Gestaltung zielt darauf, die Banalität von Artefakten möglichst stilvoll zu überwinden. So verstanden, lässt sich auch das geometrische Vokabular amerikanischen Minimal Künstler im Sinne eines ornamentalen Kanons verstehen. Hier berührt sich das Ornament ganz grundsätzlich mit der Abstraktion, so wie der Kunsthistoriker Markus Brüderlin in seiner bahnbrechenden Publikation „Ornament und Abstraktion“ die Entstehung letzterer aus ersterem nachgewiesen hat. Schauen wir auf die Werke von Heike Weber, lässt sich diese Entwicklung in ihnen deutlich ablesen. Ihre Arbeiten in Goslar kreisen alle um das Motiv des Teppichs. Aber dieses Motiv wird von ihr in mehrfachem Sinne entleert und abstrahiert. Bei ihren Rauminterventionen nutzt sie allein die Ornamente des Teppichs, während der Teppich selbst als Artefakt weitgehend verschwindet. Und auch seine Ornamente sind für sie lediglich Anregungen für freie Gestaltungen. Was in ihren Werken an Schmuckfiguren auftaucht, sind keineswegs Zitate, sondern Evokationen. Und die gehen in sehr unterschiedliche Richtungen. Zum einen erinnert ihre Ornamentik an Teppichmotive türkischer Kelims, zum anderen aber auch an Module der amerikanischen Minimal Art. Hat sie erstere bei einem mehrmonatigen Studienaufenthalt in der Türkei kennen gelernt, so sind letztere Teil ihrer ästhetischen Sozialisation. Ihr gemeinsamer Auftritt in der Goslarer Werkgruppe, ist, so gesehen, auch ein Beitrag zu interkultureller Verständigung.
Raumbild und Bodenskulptur Dabei steht die subjektive Anverwandlung der Motive durch die Künstlerin im Vordergrund. In ihren vier Arbeiten zeigen sich zwar immer wieder Anklänge an das ideologische und narrative Potential des Ornaments, aber die bleiben äußerst diskret. Als ferne, wenn auch deutlich vernehmbare Echos der Kunst- und Kulturgeschichte grundieren sie ihre Werke, in denen Heike Weber die ästhetische Auseinandersetzung mit Raum und Zeichnung, Linie und Form in den Vordergrund stellt. Als erstes Werk begegnet dem Besucher der Goslarer Ausstellung ihre Teppicharbeit, die sich auf dem Boden des dreißig Meter langen und schmalen Flurs befindet, der sich mehr oder weniger gerade durch die obere Etage des Ausstellungshauses zieht. Mit ihr liegt gewissermaßen Teppich auf Teppich. Die Künstlerin hat die Struktur ihres Werkes mit Hilfe des Computers entwickelt und für sie das Motiv eines Buschbohnennetzes genutzt. Die an abgerundete Rauten erinnernden Formen verschieben sich konstant gegeneinander und überlagern sich, wobei sie stets in derselben Ebene bleiben. Sie erinnern an miteinander agierende Vexierbilder, die gleich bleiben und doch immer wieder anders sind. Weber hat die Formen aus einem gelben Teppichboden ausgeschnitten und auf den bereits vorhandenen, dunkelgrauen Teppichboden gelegt. Dabei wird der ursprüngliche Boden zum Bildgrund, die gelben Rautenformen dagegen zum Protagonisten eines beeindruckenden Raumbildes oder auch einer Bodenskulptur, je nachdem aus welcher Perspektive man auf die Arbeit schaut. An sich ist das von ihr verwendete Motiv ein ganz und gar rationales, kartesianisches Ornament. Clare et distincte. Aber durch das Moment der Formverschiebung wird es diffus und fängt an zu flimmern. Schaut man den Flur hinunter, glaubt man, seinen Augen nicht zu trauen. Als dehne sich der Boden und würde weit, dann wieder sieht er eng und wie aufgerissen auf. Das Klare und Eindeutige wird unsicher und vieldeutig. Die Intervention ist eine der schönsten und lakonischsten Statements zum Stand der Dinge im Werk von Heike Weber. Als habe die Wirklichkeit Löcher und sei porös. Vermittelt sich ein solcher Eindruck in diesem Eingriff eher metaphorisch, dann in ihrer zweiten Teppicharbeit ganz direkt. Für deren Ornamentik und Komposition hat sich die Künstlerin von einem türkischen Kelim inspirieren lassen. Aber statt ihren Teppich aus textilen Fäden zu weben, hat Weber ihn aus schwarzem Silikon aus dem Baumarkt geformt. Wie der mythische Faden der Ariadne besteht er bis auf die Rosette in seiner Mitte aus einer einzigen, sich zu immer neuen Formen und Verbindungen verschlingenden Linie.
Tanz der Formen Das Silikon macht den Teppich empfindlich und zum Begehen ungeeignet. Er ist ausschließlich Schauobjekt Im Raum. Auch er ist wesentlich Form und liegt auf einem hellen Untergrund aus grauem Linoleum auf. Er operiert mit einer ähnlichen Dialektik von Fülle und Leere wie der Teppich im Flur. Beide Werke könnten uns an einen Dialog in Georg Büchners Drama „Dantons Tod“ erinnern, in dem die existenzielle Verunsicherung während des Epochenumbruchs der französischen Revolution von 1789 beschrieben wird. Als ein Herr einem andern die Hand reicht, um ihm über eine Pfütze hinwegzuhelfen, bedankt der sich mit den bezeichnenden Worten: „Ja, die Erde ist eine dünne Kruste; ich meine immer, ich könnte durchfallen, wo so ein Loch ist. Man muss mit Vorsicht auftreten; man könnte durchbrechen.“ In dieser Perspektive entwickeln Webers Werke und Ihre Ornamente einen gefährlichen Subtext, der das Reich des harmlos Dekorativen und Gemütlichen weit hinter sich lässt. Das erstreckt sich auch auf die Papierarbeiten der Künstlerin, deren Kompositionen sich einmal mehr an der Geometrie, den Medaillons und Rosetten der Kelims anlehnen, während die Formen ihrer Ornamente freier Erfindung folgen. Indem die Künstlerin auch ihre Farbe frei fließen lässt, werden die Motive unklar. Gebildet aus einem Gewirr fallender, feiner, Webfäden gleicher Linien, erscheinen sie wie hinter einem Schleier. Man glaubt zu sehen, wie sie zerfließen und sich auflösen. Einmal mehr gerät die Welt aus den Fugen einer fest gefügten Ordnung. Ein solcher, wenn auch heiter intonierter Eindruck bestimmt auch Heike Webers letzte Arbeit in Goslar. Sie besteht aus roten und grünen, leicht verzogenen Ringen und Kreisen aus Teppichboden. In einem tollen Tanz und Wirbel besetzen sie, allein oder miteinander verwoben, wie ein außer Rand und Band geratener Gobelin die vier Wände und den Boden eines nach oben hin offenen Raumes. Sie sind alle unterschiedlich groß und ihre runde Form stellt sich gegen das Rechtwinkelige des Raums, dessen orthogonale Faktur sich unter dem Ansturm dieser eher organischen Formen aufzulösen scheint. Aber nicht im negativen Sinn, als verlöre man dabei den Boden unter den Füßen. Sondern im Sinne einer positiven Entgrenzung, die uns – so der subjektive Eindruck – befreit und aller Einschränkungen von Raum und Zeit enthebt. Als Betrachter im Raum werden wir zum Teil dieser mit barockem Formenreichtum und freudigem Bewegungsdrang aufwartenden Skulptur. Großzügig lässt sie uns teilhaben en einer dionysischen Lebensfreude, deren Schatten für dieses Mal unsichtbar bleiben.